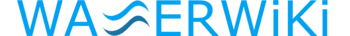Enzyklopädie, Glossar und Informationen zu Wasserquellen
| Begriff | Definition |
|---|---|
| Gewässerschutz | Als Gewässerschutz wird die Gesamtheit der Bestrebungen bezeichnet, die Gewässer (Küstengewässer, Oberflächengewässer und das Grundwasser) vor Beeinträchtigungen zu schützen. Der Gewässerschutz steht in engem Zusammenhang mit dem Bodenschutz und hat die Reinhaltung des Wassers als Trink- oder Brauchwasser zum Ziel und den Schutz dieser Lebensräume als aquatische, das heißt vom Wasser abhängige, Ökosysteme.
https://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/1491239/1101391 https://www.dornbirn.at/leben-in-dornbirn/umwelt/fliessgewaesser
|
| Gewässersohle |
Zwischen den beiden Uferzonen der am tiefsten gelegene Bereich des Gerinnebettes eines Fließgewässers. Häufig wird der Begriff auch synonym für das Gerinnebett verwendet. Neben dem Auftreten unterschiedlicher Substrattypen ist eine Untergliederung in verschiedene Sohlentypen möglich, die sich in Abhängigkeit von den hydraulischen Verhältnissen gebildet haben. Der Bereich, in dem sowohl Sand als auch gröberer Kies bewegt wird, wird als gemischtkörnige bewegliche Sohle bezeichnet. Neben dieser lockeren Lagerung existiert auf beiden Gewässersohlenseiten eine Zone der Grobkornanreicherung sowie der Sohlenpflasterung, bei der nur noch grobe Komponenten die Zusammensetzung bestimmen und die Sohle vor weiteren Abtragungen schützen. Selbst bei höheren Abflüssen wird die gepflasterte Sohle nicht an dem Geschiebetrieb im Gerinne beteiligt, der weitgehend über der gemischtkörnigen Zone erfolgt. Der geschiebeführende Stromsohlenbereich wird als geschiebeführende Breite bezeichnet. Die Strukturierung der Gewässersohle durch Bank- und Inselbildungen zeigt das vorhandene Strukturbildungspotenzial des Fließgewässers an. Die Gewässersohle wird als Parameter bei der Bewertung der Gewässerstrukturgüte zur Beurteilung der ökologischen Funktionsfähigkeit im Hinblick auf die Ausbildung von Habitaten und das Regenerationsvermögen herangezogen. Naturbelassene und intakte Bach- und Flussbetten sind nicht nur wesentlich für im Wasser lebende Tiere und Organismen, sondern auch für Überbewohner, beispielsweise viele Vogelarten, die sie als Lebensraum benötigen.
https://www.spektrum.de/lexikon/geographie/gewaessersohle/3054
|
| Gewässertypen | Zur Typisierung von Gewässern werden verschiedene Kriterien herangezogen. Eine klassische Einteilung ist die in Meere sowie Binnengewässer und Grundwasser. Bei der Vielzahl der Gewässertypen finden sich zahlreiche Grenz- und Übergangstypen. An Hand folgender Kriterien können Gewässer typisiert werden:
https://de.wikipedia.org/wiki/Gew%C3%A4sser
|
| Geysir | Vulkanisch erhitztes oder mit Kohlenstoffdioxid versetztes Grundwasser bildet beim Austritt wiederholt Fontänen, bei großen Sprunghöhen werden diese Austritte Geysire genannt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Quelle#Einteilung_nach_Strukturmerkmalen_im_Quelleinzugsgebiet
|
| Gezeiten | Wasserbewegung der Meere infolge der Gravitation von Mond und Sonne. Der Wasserspiegel sinkt (Ebbe, ablaufendes Wasser) und steigt (Flut, auflaufendes Wasser) periodisch. Sein Tiefpunkt heißt Niedrigwasser, sein Hochpunkt Hochwasser. Die durchschnittliche Differenz beider Werte wird als Tidenhub bezeichnet. Bestimmte Konstellationen von Sonne, Mond und Erde führen zu besonderen Tiden: Bei Voll- und Neumond liegen die drei Himmelskörper etwa auf einer Linie, so dass sich die Gezeitenkräfte zu einer besonders großen Tide addieren, der Springtide. Bei Halbmond bilden sie einen rechten Winkel mit der Erde im Scheitelpunkt, was zu einer besonders kleinen Tide führt, der Nipptide.
Neben dem Wasser der Meere ist auch der feste Teil der Erde den Gezeitenkräften unterworfen. Im Vergleich zum beweglicheren Wasser ist hier die Verformung allerdings gering. |
| Gezeitenkraft | Gezeitenkräfte treten auf, wenn sich ein ausgedehnter Körper in einem äußeren Gravitationsfeld befindet, dessen Stärke räumlich variiert. Die auf der Erde nachweisbaren Gezeitenkräfte werden durch Mond und Sonne verursacht und rufen (unter anderem) die Gezeiten hervor.
http://biancahoegel.de/astronomie/physik/gezeitenkraft.html https://de.wikipedia.org/wiki/Gezeitenkraft
|
| Gießen | Quellaustritte unter Wasser in Altarmen und sonstigen Fließgewässern der Flussauen. |
| Gips | Bei Gips handelt es sich um ein häufig vorkommendes Material aus der Gruppe der Sulfate. Gips ist meist farblos oder weiß. Durch Aufnahme von Fremdionen oder Beimengungen unterschiedlicher Art kann dieser eine gelbliche, rötliche, graue oder braune Farbe annehmen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Gips
|
| GIS | Unter Geoinformationssystemen, kurz GIS, versteht man Informationssysteme zur Erfassung, Bearbeitung, Organisation, Analyse und Präsentation räumlicher Daten. Heutzutage findet GIS in nahezu allen Naturwissenschaften Verwendung und ist ein essentielles Instrument zur Aufarbeitung naturräumlicher Fragestellungen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Geoinformationssystem
|
| Glaubersalz | Bei Glaubersalz handelt es sich um ein Decahydrat des Natriumsulfats. In der Natur kommt es in Meerwasser, in salzigen Seen sowie in mineralischen Quellen meist aber mit einem sehr geringen Gesamtanteil vor. In der Medizin wird es häufig als salinisches Abführmittel eingesetzt. Der Geschmack von Glaubersalzwasser ist ausgesprochen bitter. |
| Glaziokarst | Von Glaziokarst spricht man, wenn ein Karstgebiet im Pleistozän großflächig vergletscherte und zumeist erst nach Abschmelzen der Gletscher die Verkarstung aktiviert wurde. Damit sind Mischformen aus glazialen Erosions- und Karstlandschaften entstanden, die weitflächig in den Kalkalpen Karwendel, den Hochdinariden Orjen, dem Taurus, im Picos de Europa, den Pyrenäen oder dem Kaukasus auftreten. Typische Erscheinungsformen des Glaziokarstes sind überwiegend im Hochgebirge anzutreffen. Bekannt unter den rezenten Karstgletschern sind diejenigen des Dachsteingebirges. In Nordeuropa finden sich Glaziokarstlandschaften auch auf verebneten Kalkflächen, die vorher vom Inlandeis bedeckt waren. Wenn in südlicheren Regionen unterhalb von 1000 Hm Erscheinungen des Glaziokarstes auftreten, sind sie durch tief liegende Schneegrenzen im Pleistozän verursacht. Kennzeichen des Glaziokarstes sind flache Dolinen, Schichttreppen, große vertikale Schächte (durch Gletscherschmelze) und vielfältige Kleinformen auf typischen Glazialformen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Glaziokarst https://de.linkfang.org/wiki/Glaziokarst
|
| Glaziologie | Glaziologie ist die Wissenschaft von Formen, Auftreten und Eigenschaften von Eis und Schnee samt ihren Ausformungen als Gletscher, Permafrost und Schelfeis. Sie ist aus der ursprünglichen Gletscherkunde hervorgegangen, die ihren Beginn im 19. Jahrhundert in der Schweiz hatte.
https://www.enzyklo.de/Begriff/Glaziologie
|
| Gleithang | An der Kurveninnenseite von Fliessgewässern durch kontinuierliche Sedimentation entstehender Uferbereich. |
| Gletscherbach | Bach, der von dem Schmelzwasser eines Gletschers gespeist wird und aus diesem an seiner Gletscherzunge in einem meist höhlenförmigen Ausgang hervortritt, dem Gletschertor. Sein Wasser ist durch mitgeführtes, fein zermahlenes Gestein oftmals milchig trüb und wird daher als Gletschermilch bezeichnet.
|
| Gletscherlauf | Aus dem isländischen wörtlich übersetzte Bezeichnung für das plötzliche durch natürliche Vorgänge (z.B. Vulkanismus) hervorgerufene Entleeren eines unter einem Gletscher befindlichen Sees in Form von Flutwellen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Gletscherlauf
|
| Gletschermühle | Gletschermühlen sind spiralwandige Hohlformen im Eis, die von an der Gletscheroberfläche oder in Spalten in Wirbelform abfließendem Schmelzwasser geschaffen worden sind. Das Schmelzwasser versetzt dabei Gesteinstrümmer verschiedener Korngrößen in kreisförmige Bewegung. Sie erweitern und vertiefen die Gletschermühle und werden dabei selbst rundgeschliffen. Gletschermühlen können Durchmesser von bis zu 20 Metern erreichen und entstehen meist in flachen Bereichen des Gletschers mit horizontalen Gletscherspalten. Sie können bis zum Grund des Gletschers reichen und hunderte Meter tief sein. Für die Glaziologie spielen Gletschermühlen eine wichtige Rolle, weil man durch sie leicht in das Innere eines Gletschers kommt. Die Bezeichnung Mühle wurde von dem mahlenden, meist rotierenden Abfluss des Schmelzwassers abgeleitet.
https://de.wikipedia.org/wiki/Gletscherm%C3%BChle https://www.wikizero.com/de/Gletscherm%C3%BChle
|
| Gletscherquellen | |
| Gletschertopf | Gletschertöpfe, auch Riesentöpfe genannt, sind topf- oder schachtartige Vertiefungen in Felsgestein (Kolke), die durch fließendes Wasser im Bereich von Gletschereis entstehen. Sie bilden sich durch Schmelzwasser, das durch die Gletscherspalten und insbesondere Gletschermühlen zum Gletscherbett hin abfließt. Dieses Schmelzwasser vereinigt sich zu Strömen und bildet an gewissen Stellen Wirbel. In diesen Wirbeln herrschen Fließgeschwindigkeiten von bis zu 200 km/h und hoher Druck. Die Haupterosionsarbeit mit Aushöhlen des Felsbettes leisten dabei der mitgeführte Sand und die Kiespartikel.
https://steine.helga-ingo.de/2012/04/06/gletschertopf/ https://de.wikipedia.org/wiki/Gletschertopf
|
| Grabenentwässerung | Entwä#sserung durch offene Gräben |
| Grauwasser | Die Europäische Norm 12056-1 definiert Grauwasser als fäkalienfreies, gering verschmutztes Abwasser, wie es etwa beim Duschen, Baden oder Händewaschen anfällt, aber auch aus der Waschmaschine kommt und zur Aufbereitung zu Brauch- bzw. Betriebswasser dienen kann. Zur Schonung der Trinkwasserreserven kann es beispielsweise zur Toilettenspülung verwendet werden, die in Deutschland 27% des privaten Wasserverbrauchs ausmacht.
https://www.enregis.de/de/abwasser
|
| Gravitationsquelle | Bei Gravitationsquellen fließt das Grundwasser mit freiem Wasserspiegel durch den Aquifer und folgt dabei der Morphologie des oberirdischen Abflussnetzes. Es tritt an die Oberfläche, wenn sich Grundwasserspiegel und Geländeoberkante treffen. Gravitationsquellen werden aus topografisch höher liegenden Bereichen gespeist und können in Schüttung und Wasserqualität durch ihre starke Abhängigkeit vom hydrologischen Zyklus und der Grundwasserneubildungsrate stark variieren. Durch die teilweise kurze Bodenpassage und die geringe Tiefenlage des Grundwassers sind sie einem erhöhten Verschmutzungsrisiko ausgesetzt.
|
| Grubenwasser | Grubenwasser ist bergmännisch für das Wasser, das in Bergwerken zusammen mit der Rohstofförderung gefördert wird. Die angewendete Technologie wird Wasserhaltung genannt. Sie spielt auch (unendlich) lange nach Schließung eines Bergwerks möglicherweise noch eine Rolle. Da Grubenwässer die Temperatur des Gebirges haben, aus dem sie Kommen, können sie je nach Teufe und Anwendung mit oder ohne Wärmepumpe geothermisch genutzt werden. Im Ruhrgebiet könnte z. B. der geothermischen Grubenwassernutzung im Zuge der 'Wärmewende' eine große Bedeutung zukommen.
https://www.geothermie.de/bibliothek/lexikon-der-geothermie/g/grubenwasser.html
|
| Grundlos | |
| Grundwalze | ist eine Wasserwalze an der Sohle eines Fließgewässers mit horizontaler Drehachse und flussaufwärts gerichtetem Drehsinn, die besonders nach natürlichen oder künstlichen Unregelmäßigkeiten im Flussbett (z.B. Stromschnellen) entstehen kann. |
| Grundwasser | Grundwasser ist unterirdisches Wasser, das die Hohlräume der Erdrinde (Poren, Klüfte u. dgl.) zusammenhängend ausfüllt, unter gleichem oder größerem Druck steht, als er in der Atmosphäre herrscht, und dessen Bewegung durch Schwerkraft und Reibungskräfte bestimmt wird. Gut durchlässige Boden- oder Gesteinskörper, in deren Hohlräumen Grundwasser fließen oder stehen kann, bezeichnet man als Grundwasserleiter oder Aquifere. Diese werden nach unten von Grundwasserstauern begrenzt, das sind gering durchlässige Boden- oder Gesteinskörper. Es macht etwa 30% der Süßwasserressourcen der Erde aus.
|
| Grundwasser als Lebensraum | Der Untergrund ist nicht nur ein wichtiger Wasserspeicher, sondern auch ein Lebensraum, den eine vielfältige Organismengemeinschaft besiedelt. Das wohl größte limnische, also Süßwasser bestimmte Ökosystem erstreckt sich weltweit im Grundwasser (Grundwassertiere = Stygofauna) und übernimmt wichtige Mittlerfunktionen im globalen Wasser- und Naturkreislauf. Grundwassertiere wurden vermutlich schon vor über 460 Jahren entdeckt. Im Jahr 1541 fanden die Menschen erste blinde Höhlenfische in einer Höhle in China. Ungefähr 150 Jahre später be-schrieben Forscher den Fund eines Grottenolms in einer slowenischen Karsthöhle. Diesem ungewöhnlichen Tier fehlen Augen und Körperfarbe – äußere Merkmale, die für Grundwassertiere ganz typisch sind. Auch wenn dieser Lebensraum für uns verborgen und nahezu unzugänglich ist und viele seiner Facetten noch unerforscht sind, wissen wir doch schon einiges über dieses einzigartige Ökosystem und seine Bewohner, die auf besondere Weise an die kargen Bedingungen im Grundwasser angepasst sind. Grundwasserleiter (vgl. Aquifer) ist ein Gesteinskörper, der Hohlräume aufweist und daher geeignet ist Grundwasser weiterzuleiten. Entsprechend der Beschaffenheit der Grundwasserleiter lassen sich drei Grundtypen unterscheiden:
Neben diesen drei Grundtypen sind in der Natur auch Zwischentypen anzutreffen, wie z.B. ein geklüfteter Sandstein, der neben der Kluft- bzw. Trennfugendurchlässigkeit noch eine deutliche Porendurchlässigkeit aufweisen kann. spektrum.de/lexikon/geowissenschaften Die Elastizität des Grundwasserleiters wird von der Kompressibilität des Grundwassers sowie der Kompressibilität des Korngerüstes bestimmt und steht damit im direkten Zusammenhang mit dem Speicherkoeffizienten in einem gespannten Grundwasser (Aquifer).
https://www.spektrum.de/lexikon/geowissenschaften/grundwasserleiter/6481 https://www.geocaching.com/geocache/GC5TJXB_die-gletscherquellen-in-der-ramsau
|
| Grundwasserleiter | Gesteinsschicht oder Gesteinskörper mit Hohlräumen und daher geeignet zur Leitung von Grundwasser, erstreckt sich nur über gesättigte Zonen. |
| Grundwasserleiter | Als Grundwasserleiter bezeichnet man einen Gesteinskörper der die Eignung besitzt Grundwasser weiterzuleiten. |
| Grundwasserschutz | Das Leitziel des Grundwasserschutzes ist es, die Qualität des nicht verunreinigten Grundwassers zu erhalten. Des Weiteren gilt es, vorhanden Schädigungen zu sanieren und eine maßvolle Entnahme sicherzustellen.
https://www.modellskipper.de/Maritimes/maritime_Begriffe_Deutsch_Abschnitt_G/Grundwasserschutz
|
| Grundwassersee | Ein Grundwassersee entsteht in einer Grube, welche tiefer liegt als der Spiegel des Grundwassers am jeweiligen Ort. Gelegentlich werden auch unterirdische Grundwassermengen, die in unterirdischen Senken anstehen, als Grundwasserseen bezeichnet Wasserflächen, die nur zeitweise durch gestiegene Grundwasserspiegel während Hochwasserlagen entstehen, und Quellseen, also an die Oberfläche tretende Grundwasserspiegel, die in Oberflächenfließgewässer übergehen, werden üblicherweise als Druckwassersee, nicht aber als Grundwasserseen bezeichnet.
https://de.wikipedia.org/wiki/Grundwassersee
|
| Grundwasserspiegel | Der Grundwasserspiegel ist die maximale Höhe, bis zu der unterirdisches Wasser reicht. Liegt der Grundwasserspiegel hoch, so kann er bereits beim Ausheben einer Baugrube sichtbar werden. Andernorts müssen tiefe Brunnen gebohrt werden, um an Grundwasser zu gelangen. Die Höhe des Grundwasserspiegels ist stark abhängig vom geologischen Aufbau bzw. der geologischen Schichtung einer Gegend, von Niederschlägen, von Grundwasserentnahmen und von baulichen Eingriffen, die in die Tiefe reichen. Aus diesem Grund kann er großen Schwankungen unterworfen sein. Tendenziell wird in vielen Gegenden weltweit ein Absenken des Grundwasserspiegels beobachtet. Das hat gravierende Auswirkungen auf austretendes Grundwasser in Quellen, Brunnen und Wasserlöcher, die mit sinkendem Grundwasserspiegel versiegen. Zudem veröden durch das Fallen des Grundwasserspiegels nicht nur natürliche Feuchtgebiete, sondern es versteppen auch weite Gebiete, wie es sich beispielsweise in Spanien beobachten lässt. |
| Grundwasserstand | Der Grundwasserstand beschreibt die Höhe des Grundwasserspiegels in Bezug auf einen Referenzpunkt. Bei diesen handelt es sich zumeist um amtlich festgelegte Bezugspunkte. |
| Grundwasserstockwerke | Grundwässer sind oftmals in verschiedene Stockwerke untergliedert, welche durch undurchlässige Schichten voneinander getrennte Grundwasserleiter darstellen.
https://www.umweltdatenbank.de/cms/lexikon/33-lexikon-g/2574-grundwasserstockwerke.html
|
| Grundwasserströmung | In wasserdurchlässigen Gesteinen kann sich Grundwasser gravitationsbedingt strömend fortbewegen. In oberflächennähe strömt Grundwasser zur zugehörigen Vorflut (Oberflächengewässer) mit dem es eine hydrologische Einheit bildet. In tieferen Schichten ist die Grundwasserströmung grundsätzlich dreidimensional zu betrachten.
https://www.geothermie.de/bibliothek/lexikon-der-geothermie/g/grundwasserstroemung.html
|
| Grundwasserzönose | Lebensgemeinschaft von Grundwasserorganismen |
| Gumpe | Ein Kolk (regional: Kulk: auch Strudelloch oder, in Festgestein Strudeltopf) ist eine Erosionserscheinung in einem Flussbett in Form einer Vertiefung in der Fließgewässersohle oder der Uferwand. Der Begriff wird überwiegend im ursprünglich niederdeutschen Sprachraum verwendet und überschneidet sich in der Bedeutung mit Gumpe, das eher im süddeutschen Sprachraum verbreitet ist und sich vorwiegend auf Aushöhlungen am Fuß von Wasserstürzen bezieht. Auslöser können Unregelmäßigkeiten in der Festigkeit des Untergrundes sein oder Fließhindernisse wie Baumwurzeln oder Steine in Sand- und Schotterbetten. Durch Strudel und Wasserwalzen bilden sich trichter- oder kesselförmige Vertiefungen. Die auskolkende Tätigkeit des fließenden Wassers heißt Evorsion, die Initialform eines Kolks Strudelnische.
https://www.jewiki.net/wiki/Kolk https://www.wikizero.com/de/Kolk https://de.wikipedia.org/wiki/Kolk
|
| Haff | Brackwasserhaltiges Küstengewässer mit meist geringem Salzgehalt, das durch eine Landzunge (Nehrung) oder vorgelagerte Inseln vom Meer getrennt ist.
|
| Haftwasser | Als Haftwasser wird im Boden entgegen der Schwerkraft gehaltenes Wasser, welches in Poren kleiner 10μm durch die Oberflächenspannung des Wassers haften bleibt. |
| Hangquelle | Eine Hangquelle oder auch Schichtquelle entsteht zumeist an Berghängen, wenn Grundwasser in einer wasserdurchlässigen Schicht (z. B. Sand) über einer relativ wasserundurchlässigen Schicht (z.B. im Jura an der Schichtengrenze zwischen Kalkstein und Mergel) liegt und beide einseitig geneigt sind. Das Wasser tritt dann am tiefsten Punkt der wasserdurchlässigen Schicht aus, wo sie an einem Hang angeschnitten ist. Streichen die Schichten in breiter Front aus, entsteht ein Quellsaum.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Schichtquelle
|
| Hartes Wasser | Wasser, in dem relativ große Mengen von Mineralien, vorwiegend Kalzium- und Magnesiumsalze, gelöst sind.
|
| Hauptquelle | Wird zumeist verwendet für die erste oder stärkste Quelle eines größeren Fließgewässers, das im Bereich seines Ursprungs häufig auch von ein oder mehreren Nebenquellen gespeist wird. |
| Hauptzuleiter | offener Graben oder geschlossene Leitung, die dem Bewässerungsgebiet das Wasser zuführt |
| Hausbrunnen | sind kleine Wasserversorgungsanlagen mit eigener Wassergewinnung und eigenem Leitungsnetz, ihre Wassergewinnung erfolgt meist aus Schachtbrunnen, Bohrbrunnen oder künstlich gefassten Quellen auf eigenem Grundstück. Bedeutung haben sie vor allem im ländlichen Raum mit eingeschränkten Zugangsmöglichkeiten zu öffentlichen Trinkwassernetzen. Ein Hausbrunnen erfordert Anmeldung und Genehmigung, der private Anwender ist für die Sicherstellung und den Nachweis der Wasserqualität (Qualitätsanforderungen der deutschen Trinkwasserverordnung )selbst verantwortlich – und das unabhängig von der Nutzung als Trinkwasser.
|
| Heilbad | Heilige Quellen Quellen galten den Kelten und vermutlich schon früheren Kulturen als heilige Orte und Kultstätten. Als wichtige Trinkwasserlieferanten bildeten sie zudem Kernpunkte menschlicher Siedlungstätigkeit. Ihrem Wasser wird oftmals eine reinigende oder heilende Wirkung zugeschrieben. Die vorchristliche Verehrung von Quellorten wurde vielfach vom Christentum übernommen und fortgeführt, weshalb an Quellen häufig Kirchen, Kapellen, Marienstatuen oder Heiligenbilder zu finden sind, insbesondere dort, wo das Wasser als besonders "wundertätig" und heilig angesehen wird, wie etwa das des Wallfahrtsortes Lourds. Vgl. Wunderquelle Auch zahlreiche Sagen und Legenden zeugen von der besonderen Bedeutung von Quellen in früheren Zeiten. Aus dieser Sicht besitzen entsprechende Quellen auch kulturhistorische Bedeutung. |
| Heilquelle | Quelle mit Heilwasser, das zu Trink- oder Badezwecken genutzt werden kann. Für eine offizielle Zulassung sind genau definierte Kriterien zu erfüllen, zu denen neben chemischen und mikrobiologischen Parametern auch eine gleichbleibende bzw. nur wenig variierende Wasserqualität zählt. Häufig wird der Begriff weitergehend auch genutzt für Quellen, die in der Tradition des Volksglaubens eine heilende Wirkung besitzen und ohne eine behördliche Zulassung von Teilen der Bevölkerung als "heilige Quellen" (gleicher Wortstamm wie "heilend") verehrt und genutzt werden. |
| Heilwasser | Mineralwasser mit vorbeugenden, lindernden oder heilenden Eigenschaften aufgrund seiner natürlichen Zusammensetzung an Mineralstoffen. Es unterliegt dem Arzneimittelgesetz und Bedarf der Zulassung durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM).
https://www.mineralienrechner.de/wasserlexikon/heilwasser/ |
| Heilwasser | Mineralwasser mit vorbeugenden, lindernden oder heilenden Eigenschaften aufgrund seiner natürlichen Zusammensetzung an Mineralstoffen. Es unterliegt dem Arzneimittelgesetz und Bedarf der Zulassung durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM).
|
| Heiße Quelle | Quellen, dessen Wasser aus Tiefen kommt, in denen hohe Temperaturen herrschen. Die Temperatur des Quellwassers liegt deshalb ständig mehr oder weniger weit über dem Jahresdurchschnitt der Lufttemperatur des Einzugsgebietes. Thermalquellen finden sich vor allem in tektonischen Bruchzonen und in Gebieten tätiger oder erloschener Vulkane.
https://wurdarborn.hpage.com/quellen.html
|
| Heißwasseraquifer | Ein Heißwasseraquifer ist eine geothermische Lagerstätte in der die Flüssigkeit auf Grund der hohen Temperatur und des hohen Drucks als heißes Wasser vorliegt. |
| Helokrene | Auch Sickerquelle, Sumpfquelle, ist durch flächig austretendes Grundwasser gekennzeichnet, das sich in einem Quellsumpf aus kleinsten Quellrinnsalen sammelt. Ein solches Quellgebiet kann sich, je nach klimatischer und geologischer Situation, über Quadratkilometer erstrecken. Im Flachland haben Helokrene, abgesehen von einigen aufsteigenden Quellen, meist eine geringe Schüttung.
https://de.wikipedia.org/wiki/Quelle#Einteilung_nach_Strukturmerkmalen_im_Quelleinzugsgebiet
|
| Himmelsteich | Ein Himmelsteich oder Himmelsweiher ist ein Stillgewässer, das durch keinen oberflächigen Zustrom gespeist wird und Wasser ausschließlich aus Niederschlägen bezieht, also vom Himmel befüllt wird, sowie durch Grundwasser. Himmelsteiche entstehen zumeist durch den Abbau von Bodenschätzen, beispielsweise bei Sprengungen, in oberflächigen Steinbrüchen, aufgelassenen Sandgruben oder beim Torfstich. Vereinzelt sind sie auch eiszeitliche Überbleibsel zwischen Endmoränen oder Einschlagskrater von Meteoriten. In ungestörten Himmelsteichen entwickelt sich in dem meist sauerstoffarmen Wasser oft rasch eine artenreiche Fauna und Flora, die an eine anaerobe Lebensweise angepasst ist. Kraterseen können den Himmelsteichen hydrologisch zwar gleichen, sind aber natürlicher Entstehung, beispielsweise durch Vulkanismus, Meteoriteneinschläge oder den Einsturz von Dolinen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Himmelsteich https://de.linkfang.org/wiki/Himmelsweiher
|
| Hochmoor | Hochmoore sind abhängig von einem Überschuss an Regenwasser, deren Menge den Wasserverlust durch Abfluss und Verdunstung übersteigen muss. Der Name kommt von der meist uhrglasartig in die Höhe gerichtete Wölbung, weil das Wachstum von der Mitte nach Außen erfolgt. Da sie keine Verbindung zu Grundwasservorkommen oder Oberflächengewässer haben, sind sie nährstoffarm und bodensauer. https://www.spektrum.de/lexikon/geowissenschaften/hochmoor/695 |
| Hochwasser | Hochwasser wird jener Zustand von Gewässern genannt, bei dem der Wasserstand deutlich über dem normalen, durchschnittlichen Pegelstand liegt. Hochwässer sind Naturereignisse und als solches Teil des Wasserkreislaufes. Ihre Ursachen sind vielfältig. Sie entstehen, wenn das natürliche oder durch den Menschen veränderte Abflusssystem die Wassermengen nicht mehr bewältigen kann. Neben der zeitlichen und räumlichen Verteilung der Niederschläge beeinflussen auch die Bodenbeschaffenheit, der Bewuchs, die Geländeneigung, die Größe des Einzugsgebietes sowie das Wasserrückhaltevermögen der Gewässer und ihrer Auen das Ausmaß eines Hochwassers. In Flüssen und kleineren Fließgewässern spricht man von Hochwasser, wenn der Wasserstand für längere Zeit (mehrere Tage) das Normalmaß deutlich übersteigt. Sie haben meist – je nach Art des Einzugsgebietes – eine jahreszeitliche Häufung, etwa bei der Schneeschmelze oder nach sommerlichen Starkregen. Zu unterscheiden ist zwischen Meeren und Fließgewässern: In Meeren und Gewässern mit merklichen Gezeiten (Tiden) bezeichnet Hochwasser den periodischen Eintritt des höchsten Wasserstands nach Eintreten der Flut und vor dem Übergang zur Ebbe. Hoch- und Niedrigwasser wechseln sich durchschnittlich alle 6–6½ Stunden ab, verursacht durch die Gravitation von Mond und Sonne. Besonders hohe Tiden bei Voll- und Neumond heißen Springhochwasser oder Springflut; sie können bisweilen durch Gezeitenwellen oder Wind (Driftstrom) zu einer Sturmflut verstärkt werden und eine Flachküste meilenweit überschwemmen.
https://www.wasseraktiv.at/wasser-lexikon/117,hochwasser.html https://www.potsdam.de/content/hochwasser https://www.biologie-seite.de/Biologie/Hochwasser
|
| Holokarst | Als Holokarst werden der voll entwickelte Karst tropischer, subtropischer und Teile der in den gemäßigten Breiten liegenden Karstgebiete bezeichnet. Das karsthydrologische System ist im Holokarst voll entwickelt und alle Karstformen, insbesondere die großen Einebnungsflächen der Poljen, sowie in den Tropen die Vollformen der Karstkegel treten gehäuft auf. Für den Holokarst der Subtropen ist zudem die Interferenz zu den pleistozänen Prozessen von Bedeutung. Durch eiszeitliche Abkühlung und vermehrte glaziale, fluvioglaziale und periglaziale Prozesse wurden insbesondere Karsthochgebirge sowie an deren Gebirgsfuß liegende Poljen durch die Dynamik von Gletschern umgestaltet. Dies trifft insbesondere für alle Karstgebirge des Mediterrans zu. Zum Holokarst zählen die Karstlandschaften des Dinarischen Karstes, Kegelkarstes und Turmkarstes.
https://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/752193/Karstplateau https://de.wikipedia.org/wiki/Karst
|
| Homothermie | Zustand, bei dem sich die Temperatur eines Wasserkörpers nicht mit der Wassertiefe ändert.
|
| Hüle | Bei Hülen oder Hüllweihern handelt es sich meist um künstlich angelegte Kleinstgewässer. Der Begriff entstammt den wasserarmen Hochflächen der schwäbischen Alb und des Frankenjuras. Zumeist befinden sich Hülen innerhalb gescchlossener Ortschaften, auf Feldern oder im Wald. Sie wurden auf natürlichen Vernässungsstellen angelegt und durch Regenwasser gespeist. Zur Beschleunigung der Füllung wurden nicht selten künstliche Gräben zur Wasserzuführung angelegt. Mit fortschreitendem Ausbau des Wasserleitungsnetzes haben die Hülen an Bedeutung verloren und stellen Heute nur noch ein kulturgeschichtliches Relikt dar.
|
| Huminsäuren | Hochmolekulare chemische Verbindungen, die beim Abbauprozess von biologischem Material, den Resten abgestorbener Lebewesen entstehen. Sie kommen natürlich als Huminstoffe in Humusböden, Torf und Braunkohle vor. In Wasser dissoziieren sie in ein elektrisch hoch geladenes Polyanion und eine Anzahl von Kationen. Bei der Wasseraufbereitung werden Huminsäuren mit Aktivkohlefiltern, Ionenaustauschfiltern oder Membranverfahren entfernt, da das Wasser sonst gelb gefärbt wäre. Man unterscheidet wasserlösliche und wasserunlösliche Humine, die zusammen mit den Fulvosäuren und Huminsäuren den Humus bilden. |
| Hungerbrunnen | Quellen, die nur in nassen Jahren schütten, werden häufig Hungerbrunnen genannt, was daran liegt, dass der Volksmund einen Zusammenhang zwischen dem Schütten der Quelle und einem schlechten Ertrag in einem verregneten Jahr sieht. Es handelt sich dabei jedoch eher um einen kulturell bedingten Aberglauben. Wissenschaftliche Untersuchungen an verschiedenen Hungerbrunnen konnten einen derartigen Zusammenhang nicht nachweisen.
https://www.wikizero.com/de/Karstquelle
|
| hydraulische Leitfähigkeit | Hydraulische Leitfähigkeit ist ein Maß für die Fähigkeit des Bodens oder Fels, eine bestimmte Menge Wasser und wassergebundener Stoffe bei gegebenem Druckgefälle zu transportieren. Die Dimension der hydraulischen Leitfähigkeit ist die Kenngröße K Fließlänge pro Zeitspanne, meist m/s. Die Durchlässigkeit von Böden hängt vor allem von ihrer Porösität ab, die von Fels von seiner Porösität und/oder seiner Klüftigkeit. Bestimmt wird diese Materialeigenschaft des Bodens durch die Porengrößenverteilung und die Kontinuität der Bodenporen. Den größten Wert erreicht die hydraulische Leitfähigkeit bei vollständiger Wassersättigung des Bodens, bei abnehmenden Wassergehalten verkleinert sich der Querschnitt, der im Boden für die Wasserbewegung zur Verfügung steht und die hydraulische Leitfähigkeit nimmt ab. https://www.spektrum.de/lexikon/geowissenschaften/hydraulische-leitfaehigkeit/7201 https://de.wikipedia.org/wiki/Permeabilit%C3%A4t_(Geowissenschaften) |
| Hydraulischer Widder | Wassergetriebene, intermittierend arbeitende Pumpe - auch als Stoßheber, Staudruck-Wasserheber oder Wasserwidder bezeichnet.
|
| Hydroabrasion | Unter der Hydroabrasion versteht man den Verschleiß einer Oberfläche, der durch die Strömung einer feststoffhaltigen Flüssigkeit verursacht wurde. Dieser Prozess spielt bei der marinen Erosion und der limnischen Erosion eine maßgebende Rolle. |
| Hydrobiologie | Hydrobiologie ist die Wissenschaft vom Leben im Süßwasser. Vereinzelt beschäftigt sich die Hydrobiologie auch mit Meeresorganismen (maritime Organismen). Der Übergang zwischen Hydrobiologie und Meeresbiologie ist fließend. Zunehmend wird statt des Begriffs Hydrobiologie heute der Begriff Limnologie verwendet. |
| Hydrodynamik | Die Hydrodynamik ist ein Teilgebiet der Strömungslehre. Es thematisiert das Bewegungsgesetz des Wassers und die dabei wirkenden Kräfte. |
| Hydrogeologie | Hydrogeologie ist die Wissenschaft vom Wasser in der Erdkruste und den oberirdischen Einflüssen, die damit in Wechselwirkungen stehen. Sie ist eine angewandte Disziplin der geologischen Wissenschaften. Forschungsgegenstände sind das Grundwasser und alle Faktoren, die Einfluss auf das Grundwasser haben. Die Hydrologie als angrenzender Forschungsbereich befasst sich mit dem oberirdischen Wasser.
https://www.berlin.de/umwelt/themen/wasser/artikel.156107.php
|
| Hydrographie | Der Begriff Hydrographie entstand bereits Mitte des 16. Jahrhunderts in England (von gr. Hydro = Wasser, Grafie = Schreiben). Die Hydrographie (Gewässerkunde) ist ein Teil der Geografie sowie der Geophysik und laut UNESCO „die Wissenschaft und Praxis der Messung und Darstellung der Parameter, die notwendig sind, um die Beschaffenheit und Gestalt des Bodens der Gewässer, ihre Beziehung zum festen Land und den Zustand und die Dynamik der Gewässer zu beschreiben“. Die ÖNORM-Definition lautet: „Jener Teil der Hydrologie der sich mit der quantitativen Erfassung und Beschreibung des Wasserkreislaufes auf, unter und über der Erdoberfläche und mit der Behandlung der damit zusammenhängenden Fragen beschäftigt“. Diese in der Schweiz und in Österreich gebräuchliche Beschreibung wird in Deutschland eher dem Begriff Hydrologie zugeordnet und weicht auch von der Bedeutung des englischen Wortes „Hydrography“ ab. Es handelt sich um eine Wissenschaft, die sich mit den gesamten Gewässern befasst, diese beschreibt und in Karten darstellt. Im englischen Sprachgebrauch ist ein bedeutender Bereich der Hydrographie die Herstellung und die Fortführung von Seekarten zu Navigationszwecken. Die Hydrographie behandelt auch die Lehre von der Geschiebebewegung und Geröllverfrachtung in Flüssen und an Küsten. Umweltüberwachung mit Probennahme und Analyse des Wassers sowie die Beschreibung des Gewässerzustandes sind heutzutage ein nicht unwesentlicher Teil der Hydrographie.
http://www.wasserwerk.at/home/alles-ueber-wasser/glossar/H https://www.wasseraktiv.at/wasser-lexikon/135,hydrographie.html
|
| Hydrologie | Unter Hydrologie versteht man die Lehre vom Wasser auf, in und über der Erdoberfläche (Hydrosphäre), d. h. von Vorkommen, Erscheinungsformen, Haushalt, von dem vom Wasser transportierten Material und seinen Lebewesen (Hydrobiologie) sowie von seinen Eigenschaften (Hydrochemie). Mit dem Wasser auf der festen Erdoberfläche befasst sich die Teilwissenschaft Gewässerkunde (Hydrographie), mit dem Wasser unter (in) der Erde (Grundwasser und Quellen) die Hydrogeologie; den Haushalt des Bodenwassers betrachtet die Geohydrologie; das Wasser der Atmosphäre behandelt die Hydrometeorologie. Teilgebiete der Hydrologie sind auch Limnologie (Binnengewässerkunde), Gletscherkunde und Ozeanographie.
https://www.wissen.de/lexikon/hydrologie
|
| hydrologische Trockenperiode | Periode ungewöhnlich trockenen Wetters, die lange genug andauert, so daß es zu Wassermangel kommt, der sich in den Wasserständen in Flüssen und Seen unterhalb der Normalhöhe und/oder im Rückgang der Bodenfeuchtigkeit sowie in einer Absenkung der Grundwasserstände bemerkbar macht.
|
| Hydrolyse | Die Hydrolyse beschreibt einen Prozess der chemischen Verwitterung von Silikaten. In ihm werden chemische Verbindungen des Silikatgesteins durch eine Reaktion mit Wasser gespalten. |
| Hydronym | Ein Hydronym ist der Name eines Gewässers, z.B. eines Flusses, eines Sees oder einer Quelle. Die Hydronymie beschäftigt sich mit dessen Herkunft, Bedeutung, Geschichte und regionalen Verbreitung. Außerdem erstellt sie entsprechende Systematiken. |
| Hydrophyten | (Aus altgriechisch hýdōr für Wasser und phytón für Pflanze), wird synonym für Wasserpflanzen verwendet. |