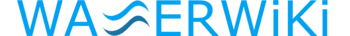Enzyklopädie, Glossar und Informationen zu Wasserquellen
| Begriff | Definition | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linksdrehendes Wasser | Der Begriff des rechts- und linksdrehenden Wassers stammt aus der Radiästhesie, in der die Drehrichtung beispielsweise mit Hilfe eines Pendels bestimmt wird. In den letzten Jahren hat er zunehmend auch Einzug in den Alltagswortschatz gehalten, nicht zuletzt in denjenigen von esoterisch ausgerichteten Menschen. Die Begrifflichkeit rechts- und linksdrehend wird auch für Lebensmittel, Gegenstände und Strahlung verwendet. Dahinter steht der Gedanke, dass alle Materie auf der Erde eine Resonanzstrahlung abgibt. Sie verhält sich, physikalisch betrachtet, wie elektromagnetische Wellen. Die Intensität der Resonanzstrahlung ist unterschiedlich hoch, insgesamt aber sehr gering. Neuere Forschungen hierzu haben ergeben, dass elektromagnetische Wellen nicht als transversale Wellen von einem Hertzschen Dipol abstrahlen, sondern in einer korkenzieherartigen Drehrichtung (Spinnresonanz). Dabei bedeutet eine Drehung im Uhrzeigersinn (von der Strahlungsquelle aus gesehen) "rechtsdrehend" oder "rechtszirkular". Eine Drehung entgegen des Uhrzeigersinns wird als "linksdrehend" oder "linkszirkular" bezeichnet. Die Radiästhesie geht davon aus, dass linkszirkulare Resonanzstrahlung, besonders bei hoher Intensität, organschädigend wirkt und hohe rechtszirkulare Resonanzen eher nervenschädigend. Eine schwächere Rechtszirkularresonanz oder auch eine stärkere, die nur kurzfristig einwirkt, gilt (je nach Wellenlänge) als eher aufbauend und förderlich. Dass Wässer besonderer Qualität physiologische und spirituell begünstigend wirken, war in früheren, intuitiv geprägten Kulturen mit hohem Naturbezug Gemeingut. Das Wasser einzelner "heiliger" Quellen war Priestern vorbehalten, das Wasser anderer Quellen galt als "heilsam", auch wenn selbst heutige Messtechnik an ihnen noch keine besonderen physikalischen oder chemischen Eigenschaften erkennen lässt. Die Radiästhesie geht davon aus, dass etwa 80% des heute genutzten Wassers linksdrehend ist, dass Heilwasser durch Außeneinflüsse oder nach einiger Zeit von rechtsdrehend nach linksdrehend umpolarisiert werden ("umkippen") kann, dass Heiliges Wasser keinen Außeneinflüssen unterliegt und grundsätzlich rechtsdrehend ist. |
|||||||||||||||||||||||||||
| Lithologie | Die Petrografie, Gesteinskunde oder Lithologie ist die Wissenschaften von Gesteinen bzw. den Materialarten der festen Erdkruste. Sie befasst sich mit der chemischen und physikalischen Beschaffenheit der Gesteine, ihrer Eigenschaften und ihrer Zusammensetzung aus einzelnen Mineralen sowie mit ihrer Körnung und teilweise der Kristallstruktur.
https://www.jewiki.net/wiki/Petrografie
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Lithosphäre | Die Lithosphäre umfasst die Erdkruste und lithosphärischen Mantel. Nach dem rheologischen Modell der Erde befindet sich unterhalb der Lithosphäre die Asthenosphäre. Das Gestein der Lithosphäre weist ein annähernd elastisches Verhalten auf. Der Übergang zu Asthenospähre ist dadurch gekennzeichnet, dass das Material an Elastizität verliert.
https://www.geothermie.de/bibliothek/lexikon-der-geothermie/l/lithosphaere.html
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Luft | Als Luft bezeichnet man das Gasgemisch der Erdatmosphäre. Luft besteht hauptsächlich aus den Gasen Stickstoff (70,09%) und Sauerstoff (20,95%). Daneben enthält sie Argon (0,93%), Kohlenstoffdioxid (0,04%), Wasserstoff und andere Gase in Spuren. Wasserdampf ist ebenfalls in wechselnden Mengen enthalten. |
|||||||||||||||||||||||||||
| Mäander | Flussschlinge in einer Abfolge weiterer natürlicher Flussschlingen bei Fliessgewässern mit geringem Gefälle und feinkörniger Geschiebefracht. Derartige Gewässer werden als mäandrierende Flüsse bezeichnet. Durch kontinuierliche Erosion an der Kurvenaussenseite (Prallhang) und gleichzeitiger Sedimentation an der Kurveninnenseite (Gleithang) greifen die Schlingen immer weiter seitlich aus. Kommt es am Ende der Schlinge zu einem Durchbruch, so bildet sich ein Altarm, der langsam verlandet.
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Maar | 1.) Die Maar: Regionale Bezeichnung für ein Feuchtgebiet oder Stillgewässer, unter anderem am Niederrhein. 2.) Das Maar: Schüssel- oder trichterförmige Mulde vulkanischen Ursprungs, eingesenkt in eine vorvulkanischen Landfläche und entstanden durch Wasserdampfexplosionen beim Zusammentreffen von Wasser und heißem Magma (phreatomagmatische Explosionen). Man unterscheudet Maarseen und Trockenmaare.
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Magma | Flüssiges Gestein des oberen Erdmantels und der unteren Erdkruste. |
|||||||||||||||||||||||||||
| Magmagestein | Magmatisches Gestein oder Magmatit ist Gestein, welches durch Kristallation beim Erkalten glutflüssiger Gesteinsschmelze entsteht. Die Magmatite sind neben den Sedimentgesteinen und den Metamorphiten eine der drei Gesteinshauptgruppen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Magmatisches_Gestein
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Magmakammer | Mit Magma gefüllter Bereich der Erdkruste, meist unter Gebieten mit vulkanischer Aktivität. |
|||||||||||||||||||||||||||
| Makrophyten | Makrophyten sind Gewächse, die auf Grund ihrer Größe als einzelnes Exemplar mit bloßem Auge sichtbar sind. |
|||||||||||||||||||||||||||
| Malm | Der Oberjura ist die oberste chronostratigraphische Serie des Jura in der Erdgeschichte. Häufig wird dieser Abschnitt auch als Malm bezeichnet. |
|||||||||||||||||||||||||||
| Malmkarst | Da die Karbonatgesteine des Malm gut wasserlöslich sind, kommt es in dieser Formation häufig zu Verkarstungen. Diese können die Wasserwegsamkeit im Malm maßgeblich bestimmen. Da diese Verkarstungen meist in größerer Tiefe durch die Einwirkung von Thermalwasser stattfinden, spricht man hier von Tiefenkarst, |
|||||||||||||||||||||||||||
| Marin | Das Meer betreffend oder auch zum Meer gehörig. Bei marinen Sedimenten handelt es sich um Meeressedimente. |
|||||||||||||||||||||||||||
| Markierungsversuch | Markierungsversuche werden durchgeführt, um Fließwege und Verweilzeiten des Wassers zu erkunden. Wasserwege und Verbindungen zwischen Einspeisungs- und Beobachtungsstellen können durch Einbringung von Substanzen in den Wasserkreislauf festgestellt werden. Außerdem liefern sie Anhaltspunkte über Fließgeschwindigkeit und Fließrichtung des Wassers und ermöglichen es Einzugsgebiete von Quellen und Brunnen abzustecken. Markierungsversuche geben somit Aufschluss über den unterirdischen und nicht sichtbaren Teil des Wasserkreislaufs.
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Marschland | Marschen sind generell flache Landstriche ohne natürliche Erhebungen. Sie bestehen aus angeschwemmten Sedimenten und liegen in etwa auf Höhe des Meeresspiegels landeinwärts des Watts und der Salzwiesen und reichen bis zur Geest, die pleistozänen Ursprungs ist. Entstehungsgeschichtlich gehören sie zu den jüngsten geologischen Formationen: Sie sind holozänen Ursprungs, also nacheiszeitlich. Wenige Dezimeter bis mehrere Meter unter dem Marschboden und flachen Meeresgebieten befinden sich glazial geformte Schichten, die denen entsprechen, die in der Geest zutage liegen. |
|||||||||||||||||||||||||||
| Mechanische Abwassserrreinigung | Die mechanische Abwasserreinigung diest zur Entfernung von festen Schweb- und Schwimmstoffen |
|||||||||||||||||||||||||||
| Meer | Das Meer ist die zusammenhängende Wassermasse der Erde, die die Kontinente umgibt. „Meere“, welche, wie das Kaspische Meer und das Tote Meer, von Land umschlossen sind, sind nicht als Meere zu definieren. Sie gelten als Binnengewässer, auch wenn erdgeschichtlich eine Verbindung zum Meer bestanden hat. Seen, die über Flüsse mit dem Meer verbunden sind, gehören, wie die Flüsse selbst, auch nicht zum Meer. Meerwasser ist wegen des hohen Salzgehaltes von rund 3,5 % für den direkten Gebrauch als Trink- und Bewässerungswasser nicht geeignet.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Meer
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Meerwasser | Meerwasser ist chemisch gesehen eine wässrige Lösung, hauptsächlich von verschiedenen Salzen (Salzwasser). Natürliches Meerwasser enthält jedoch darüber hinaus noch eine Vielzahl anderer Bestandteile, u.a. gelöste atmosphärische Gase und organische Verbindungen – nicht nur natürlichen Ursprungs.
https://www.biologie-seite.de/Biologie/Meerwasser
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Meerwasserentsalzung | Die Meerwasserentsalzung bezeichnet die Extraktion von Trink- oder Betriebswasser aus salzigem Meereswasser. Der Entsalzung können verschiedene Prozesse zu Grunde liegen. Im wesentlichen werden jedoch Salze von Wasser getrennt. In manchen Fällen fallen dabei verwertbare Nebenprodukte wie Kochsalz an.
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Merokarst | Merokarst ist die nicht voll entwickelte Karstform der kühlgemäßigten Breiten, die von Mitteleuropa und Westeuropa bekannt ist. Typisch entwickelt sind Karren und Schlucklöcher sowie kleine und flache Dolinen. Da diese Karstlandschaften immer vegetationsbestanden sind, wird hier auch vom „Grünen Karst“ (Karst unter Humus oder Sedimentschichten) gesprochen.
http://dictionary.sensagent.com/Karst/de-de/ https://de.wikipedia.org/wiki/Karst
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mesotropher See | ||||||||||||||||||||||||||||
| Messinische Salinitätskrise | Bezeichnung für sämtliche geologischen Vorgänge im Messin, einer Stufe des Meozäns vor etwa 5-7 Mio. Jahren, als aus dem damaligen Mittelmeer das weltweit größte saline Becken entstand. Kern dieser Vorgänge war die Abschnürung des vor etwa 20 Mio. Jahren gebideten "Urmittelmeer" nachdem vor etwa 15 Mio. Jahren die Afrikanische Platte mit Vorderasien kollidierte. Eine ehemals breite Wasserstraße zwischen dem heutige Marokko und Südspanien wurde so bis auf zwei relativ flache Meeresstraßen (bis zur Öffnung der Straße von Gibraltar) verschlossen. Das Mittelmeer hatte keinen Zufluss mehr. Der Meeresboden hob sich um ca. 1.000 Meter. Durch eine gleichzeitige globale Abkühlung wurde eine starke Senkung des Meeresspiegels verursacht. In wenigen zehntausend Jahren fand eine teilweise oder vollständige Verdunstung statt, was zu einem Anstieg der Salzkonzentration (Hypersalinität) des Meeresbeckens führte.
https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/Messinische%20Salinit%C3%A4tskrise https://de.wikipedia.org/wiki/Messinische_Salinit%C3%A4tskrise |
|||||||||||||||||||||||||||
| Migrakrene | Dieser auch Wanderquelle oder Linearquelle genannte Quelltyp zeichnet sich dadurch aus, dass der eigentliche Quellaustritt kaum zu erkennen ist, der Abfluss sich in geneigtem Gelände aber zunehmend mit Wasser gefüllt. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von der Linearität einer Quelle. |
|||||||||||||||||||||||||||
| Mikroorganismen | Mikroorganismen sind mikroskopisch kleine Lebewesen, die als Einzelwesen mit bloßem Auge meist nicht erkennbar sind. Es handelt sich hierbei überwiegend um Einzeller. Auch einige Mehrzeller entsprechender Größe gehören dazu. Beispiele für Mikroorganismen sind Bakterien, Pilze und mikroskopische Algen. |
|||||||||||||||||||||||||||
| Mikrophyten | veralteter Ausdruck für mikroskopisch kleine Pflanzen, die nur unter dem Mikroskop als Individuen erkennbar sind |
|||||||||||||||||||||||||||
| Mindelursprung | |
|||||||||||||||||||||||||||
| Mineral- und Tafelwasserverordnung (MTVO) | Verordnung, die das Herstellen, Behandeln und Inverkehrbringen von natürlichem Mineralwasser, Quellwasser und Tafelwasser regelt.
https://www.gerolsteiner.de/fileadmin/Contentbilder/Wasserwissen/Wasserlexikon/MTVO_2014.pdf |
|||||||||||||||||||||||||||
| Mineralquelle | Quellwasser weist einen Gehalt an gelösten Mineralen und Gasen größer als 1 g/l auf.
https://wurdarborn.hpage.com/quellen.html
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mineralstoff | Mineralstoffe sind lebenswichtige anorganische Nährstoffe, die dem menschlichen Organismus mit der Nahrung zugeführt werden müssen. Hierzu zählen die Mengenelemente (> 50mg/kg Körpergewicht) Calcium, Chlor, Kalium, Magnesium, Natrium, Phosphor und Schwefel sowie die Spurenelemente (meist < 50mg/kg Körpergewicht, Ausnahme Eisen) Eisen, Jod, Kupfer, Mangan, Molybdän, Selen. Zink und möglicherweise weitere, deren physiologische Bedeutung bisher ungeklärt ist.
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mineralwasser | Natürliches Mineralwasser stammt von unterirdischen, vor Verunreinigung geschützten, natürlichen Wasservorkommen. Seine ernährungsphysiologische Wirkung beruht auf seinem Gehalt an Mineralstoffen und Spurenelementen, der im Rahmen natürlicher Schwankungen weitestgehend konstant bleiben muss. Es darf in seinen wesentlichen Bestandteilen mit Ausnahme seines Eisen- und Schwefelgehalts nicht verändert werden. Als einziges Lebensmittel bedarf es einer amtlichen Anerkennung. Das Adjektiv natürlich dient der Betonung seines natürlichen Ursprungs, nicht der Abgrenzung zu weiteren unnatürlichen Mineralwässern.
https://www.mineralwasser.com/startseite.html |
|||||||||||||||||||||||||||
| Mirakelbuch | Bei einem Mirakelbuch handelt es sich um eine Sammlung von Wunderberichten. Sie beziehen sich zumeist auf Heilige oder auf konkrete Wallfahrtsorte, denen die gesammelten Wunder zugeschrieben werden. Nicht selten werden solche Wallfahrtsorte durch Quellen repräsentiert. Die literarische Gattung der Mirakelbücher lässt sich innerhalb der Christentumgeschichte bis in die Spätantike zurückverfolgen. Beispiele finden sich bis in die Gegenwart. Die Blütezeit erlebte die Gattung im Barockzeitalter. |
|||||||||||||||||||||||||||
| Mittelgebirgsquelle | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mofette | Eine Mofette ist der Austrittspunkt von Kohlenstoffdioxid (CO2) aus dem Boden mit Temperaturen unter 100 °C. Sie ist damit eine Unterart der Fumarole und wird als Begleiterscheinung von Vulkanismus angesehen. Der Name Mofette leitet sich vom italienischen Wort mofeta ab, welches vom lateinischen mefitis oder mephitis stammt. Es bedeutet so viel wie „schädliche Ausdünstung“. Außer Kohlenstoffdioxid können Mofetten auch Methan und Schwefelwasserstoff enthalten, in Spuren auch Helium und andere Edelgase. Sie können das umgebende Gestein an Störungen chemisch verändern. Schwefelwasserstoffanteile führen zu einem Geruch nach faulen Eiern. |
|||||||||||||||||||||||||||
| Montane Quelle | ||||||||||||||||||||||||||||
| Moor | Feuchtgebiet mit ständigem Wasserüberschuss (im Gegensatz zum Sumpf). Der Wasserüberschuss hält den Boden sauerstoffarm. Dadurch wird der vollständige Abbau organischer Reste verhindert. Sie werden stattdessen als Torf abgelagert. Moore können daher in die Höhe wachsen (Hochmoor). Der Boden ist in der Regel schwammig.
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Moorauge | In Regen- oder Kesselmooren liegende Wasseransammlung werden neben Kolk auch Moorauge genannt. Ein Kolk (regional: Kulk: auch Strudelloch oder, in Festgestein Strudeltopf) ist eine Erosionserscheinung in einem Flussbett in Form einer Vertiefung in der Fließgewässersohle oder der Uferwand. Der Begriff wird überwiegend im ursprünglich niederdeutschen Sprachraum verwendet und überschneidet sich in der Bedeutung mit Gumpe, das eher im süddeutschen Sprachraum verbreitet ist und sich vorwiegend auf Aushöhlungen am Fuß von Wasserstürzen bezieht. Auslöser können Unregelmäßigkeiten in der Festigkeit des Untergrundes sein oder Fließhindernisse wie Baumwurzeln oder Steine in Sand- und Schotterbetten. Durch Strudel und Wasserwalzen bilden sich trichter- oder kesselförmige Vertiefungen. Die auskolkende Tätigkeit des fließenden Wassers heißt Evorsion, die Initialform eines Kolks Strudelnische.
https://www.jewiki.net/wiki/Kolk https://www.wikizero.com/de/Kolk
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Moosauge | Volkstümliche Bezeichnung für Grundwasserausstöße und Quelltöpfe im Murnauer Moos. |
|||||||||||||||||||||||||||
| Moosbrille | Volkstümliche Bezeichnung für Grundwasserausstöße und Quelltöpfe im Murnauer Moos. |
|||||||||||||||||||||||||||
| Mud Pool | Ein Mud Pool, oder auch Schlammteich, als Manifestation eines tiefer liegenden geothermischen Reservoirs entsteht, wenn nicht ausreichend Wasser vorhanden ist, um einen Geysir oder eine Thermalquelle zu speisen, obgleich auch bei Schlammteichen in größerer Tiefe ausreichend Wasser vorhanden sein kann, das an der Oberfläche nicht unmittelbar zur Geltung kommt. Schlammteiche können hohe Temperaturen haben und es können sowohl Dampfblasen als auch andere Gasblasen aufsteigen.
https://www.geothermie.de/bibliothek/lexikon-der-geothermie/s/schlammteich.html
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Muldental | Ein Muldental is eine weit verbreitete, typische Talform mit muldenförmigen Talquerprofil. Charakteristisch sind die sanften Übergänge zwischen seinem tiefsten Teil und den umgebenden Hängen. Auf Grund der geringen Tiefenerosion bei gleichzeitiger Hangdenudation und fehlender Seitenerosion, fehlt der eigentliche Talboden. Typisch sind Muldentäler in gering resistenten Gesteinen, z.B. auf Hochflächen und Hügelländern der Mittelgebirge. |
|||||||||||||||||||||||||||
| Mure | Bei einer Mure handelt es sich um eine Mischung aus Fein- und Grobmaterial sowie Wasser, welche sich zumeist in Folge von Starkniederschlägen und häufig auch in Zusammenhang mit Hagel, Rinnen und Hängen folgend mit großer Geschwindigkeit hangabwärts bewegt. Eine Prävention erfolgt durch Wildbachverbauungen. |
|||||||||||||||||||||||||||
| Nachhaltigkeit | Der Begriff der Nachhaltigkeit kann auf eine Publikation von Hans Carl von Carlowitz aus dem Jahr 1713 zurückgeführt werden, in der er von der nachhaltenden Nutzung der Wälder schrieb. In Verbindung mit im erweiterten Sinne eines Zustandes des globalen Gleichgewichts wird der Begriff erst seit den 1970er Jahren gebracht. Heute gibt es einen regelrechten Disput um eine einheitliche Definition von Nachhaltigkeit. Der Grundgedanke der modernen Nachhaltigkeit wird jedoch einheitlich durch eine intergenerationale Sicherung ökologischer, ökonomischer sowie sozialer Faktoren beschrieben.
https://www.geothermie.de/bibliothek/lexikon-der-geothermie/n/nachhaltigkeit.html
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Nährstoffgehalt von Wasser | Gewässer können anhand der in ihr befindlichen Menge von Nährstoffen klassifiziert werden. Grundlegend unterscheidet man etwa bei Seen zwischen vier Trophiesystemen: Oligotroph (I), Mesotroph (II), Eutroph (III) und Hypertroph (IV). Oligotrophe Seen sind Gewässer mit nur sehr wenigen Nährstoffen, Hypertrophe Seen sind dagegen äußerst Nährstoffreich. Die zwei wichtigsten und häufigsten Trophiensysteme sind oligotrophe und eutrophe Gewässer. Seen lassen sich unter diesem Aspekt folgendermaßen systematisieren:
Durch landwirtschaftliche Nutzung, Nährstoffeintrag aus Kläranlagen und der Luft sowie vielfältige andere industriell-zivilisatorischen Einflüsse steigt der Nährstoffgehalt von Wasser trotz vieler Verbesserungsmaßnahmen weltweit noch immer an. Wegen der Kreislaufführung ist davon nicht nur von Oberflächenwasser einschließlich Meerwasser betroffen, sondern auch unter der Erdoberfläche fließendes Wasser und Gletscher. Die bekanntesten Nährstoffe sind Phosphor, Nitratstickstoff und Ammoniumstickstoff. Selbst an vielen Quellen lässt sich mittlerweile deren zu hoher Nährstoffgehalt in Form eines übermäßigen Wachstums von Faden- und Schleimalgen beobachten.
http://www.biologie-schule.de/oligotroph-eutroph.php
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Najaden | Wassernymphen, Quellnymphen, siehe Nymphen |
|||||||||||||||||||||||||||
| Nassgallen | Quellen, die aufgrund eines sehr geringen Grundwasseraustritts keinen Oberflächenabfluss besitzen.
https://wurdarborn.hpage.com/quellen.html
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Naturdenkmal | Unter Naturschutz gestellte natürlich entstandene einzelne Landschaftselemente (Naturgebilde) oder entsprechende Flächen (Flächennaturdenkmale), z.B. Bäume, Felsnadeln, Höhlen oder Parks.
https://de.wikipedia.org/wiki/Naturdenkmal
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Natürliche Vorflut | Möglichkeit des Wassers, mit natürlichem Gefälle abzufließen |
|||||||||||||||||||||||||||
| Nebenquelle | Die erste oder stärkste Quelle eines größeren Fließgewässers wird als Hauptquelle bezeichnet. Diese wird im Bereich ihres Ursprungs häufig auch von ein oder mehreren Nebenquellen gespeist. |
|||||||||||||||||||||||||||
| Nekton | Gesamtheit der pelagischen Tiere in Meeren und Binnengewässern, die unabhängig von der Strömung schwimmen können (Adjektiv: nektisch, nektonisch).
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Neptun | Der römische Gott entspricht dem griechischen Wassergott Poseidon und war ursprünglich der Gott der fließenden Gewässer, der springenden Quellen und vermutlich auch des Wetters. Ab dem 3. Jahrhundert v. Chr. wurde er dem griechischen Poseidon als Gott des Meeres gleichgesetzt. Der Mythologie zufolge wohnt er in der Meerestiefe im Gefolge niederer Meeresgottheiten. Sein Attribut ist wie bei Poseidon der Dreizack, mit dem er Meer, Flüsse und Seen beherrscht. In den Darstellungen erscheint er oft auf einer Muschel statt auf einem Wage stehend, umringt von Delphinen, seinen Boten. Wie Poseidon wird er meist im Gefolge von Nereiden dargestellt. https://de.wikipedia.org/wiki/Neptun_(Mythologie) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Nereiden | Meeresnymphen, siehe Nymphen |
|||||||||||||||||||||||||||
| Niedermoor | Niedermoore entstehen bei der Verlandung von Gewässern, unter dem Einfluss von ansteigendem Grundwasser, im Quellwasserbereich, in kesselförmigen Senken oder im Auenbereich von Flüssen. Durch ihre Verbindung zum Grundwasser oder zu Still- und Fließgewässer sind sie deutlich nährstoff- und basenreicher als Hochmoore. https://www.spektrum.de/lexikon/geowissenschaften/niedermoor/11180 |
|||||||||||||||||||||||||||
| Niederschlag | Unter dem Begriff Niederschläge wird in der Meteorologie die Ausscheidung von Wasser aus der Atmosphäre bezeichnet, das den Erdboden in flüssiger – Regen – und/oder fester Form – Hagel oder Schnee erreicht. Niederschläge sind ein wichtiger Teil des Wasserkreislaufs. Gemessen werden Niederschläge mit Regenmessern (Ombrometern). Die Niederschlagsmenge ist die Höhe der Wasserschicht, die sich bei Niederschlag auf einer ebenen Fläche gebildet hätte. Angegeben wird sie in Millimeter. 1 Millimeter entspricht dabei 1 Liter pro Quadratmeter. Mit einer Niederschlagsmenge von durchschnittlich etwa 1.100 mm pro Quadratmeter und Jahr gilt Österreich als eines der wasserreichsten Länder Europas. Jahreszeitliche und geographische Unterschiede sowie regionale Faktoren wie Wälder, Seen, Bodenart und Städte, haben Einfluss auf die Niederschläge. Klimamodelle deuten seit einigen Jahren darauf hin, dass menschliche Aktivitäten (so etwa die Verbrennung fossiler Treibstoffe) Niederschläge wie Regen und Schneefall beeinflussen.
http://www.wasserwerk.at/home/alles-ueber-wasser/wasserkreislauf/12 https://www.wasseraktiv.at/wasser-lexikon/139,niederschlag.html http://www.gbt.ch/Lexikon/N/Niederschlaege.html
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Nival | In einem nivalen Klima fallen Niederschläge vorwiegend als Schnee. |
|||||||||||||||||||||||||||
| Noor | Regionale Bezeichnung für einen bis auf eine schmale Öffnung nahezu abgetrennten seeartigen Teil eines größeren Gewässers im Raum Schleswig und in Dänemark (dän. Nor).
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Nutzwasser | Nutzwasser ist Wasser für den menschlichen Gebrauch, das nicht aus der öffentlichen Trinkwasserversorgungsanlage geliefert wird bzw. dessen Eignung als Trinkwasser nicht nachgewiesen ist. Ausgenommen in der Industrie und im Gewerbe, wo die Verwendung von qualitativ hochwertigem Trinkwasser aus zentralen Wasserversorgungsanlagen in größeren Mengen allein aus wirtschaftlichen Gründen ausgeschlossen werden kann, werden Dualsysteme in der öffentlichen Wasserversorgung nicht durchsetzbar sein. Der Nutzwassereinsatz wird in Haushalt in erster Linie für WC-Spülung, Gartenbewässerung, Waschen von Kraftfahrzeugen propagiert. Nur in diesen Bereichen ist der Einsatz von Nutzwasser aus hygienischen Gründen möglich. Nutzwasseranlagen senken nicht den Wasserverbrauch, sondern bedeuten eine Substitution (ein Ersetzen) des Trinkwassers durch Nutzwasser. Eine Entlastung des öffentlichen Trinkwassersystems durch Nutzwassersysteme im Haushalt ist gerade in Spitzenverbrauchszeiten nicht gegeben, da in längeren Trockenperioden die mit Nutzwasser versorgten Anlagen mit Trinkwasser der öffentlichen Anlage gespeist werden müssen. Das Nutzwassersystem muss vom Trinkwassersystem vollkommen getrennt sein. Auslaufhähne aus Nutzwassersystemen sind gegen die irrtümliche Entnahme als Trinkwasser zu sichern. Um bei Störfällen eine rasche Lokalisierung der Schadensursache sicherzustellen, besteht für Nutzwassersysteme im Haushalt betreffs Errichtung sowohl an das Wasserversorgungsunternehmen als auch an die zuständige Sanitätsbehörde eine Meldepflicht.
http://www.wasserwerk.at/home/alles-ueber-wasser/glossar/N https://www.wasseraktiv.at/wasser-lexikon/140,nutzwasser.html
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Nymphäum, Nymphäen | Nymphenheiligtum, eine in der Antike ursprünglich den Nymphen geweihte Brunnenanlage, meist Quell- oder Brunnenhaus. Nymphäen gibt es auch in Form natürlicher oder künstlich angelegter Grotten. In der römischen Kaiserzeit steht diese Bezeichnung auch für repräsentative Bauten der öffentlichen Wasserversorgung mit prunkvollen Fassaden, Wasserspeiern und großen Wasserbecken, die an der Mündung einer künstlichen Wasserleitung standen. |
|||||||||||||||||||||||||||
| Nymphen | Nymphen sind In der griechischen Mythologie Halbgöttinnen, die sehr lange leben können, aber nicht unsterblich sind. Als weibliche Naturgeister ist es ihre Aufgabe, die Natur zu schützen. Es gibt Wasser-, Meeres-, Baum-, Bergnymphen und viele andere. Wassernymphen werden als Najaden bezeichnet. Sie wachen über Quellen, Bäche, Flüsse, Sümpfe, Teiche und Seen. An Quellen, Hainen und Grotten wurden sie in lokaler Tradition kultisch verehrt. Ihren Gewässern wurde oft eine magische heilende Wirkung oder prophetische Kraft zugesprochen. Trocknete das Gewässer einer Najade aus, musste sie sterben. Zu den Meeresnymphen zählen die Nereiden, die 50 Töchter der Doris und des Nereus, des mit prophetischer Gabe ausgestatteten Meeresgottes der Ägäis. Nereiden, meist als Begleiterinnen des Meeresgottes Poseidon, beschützen Schiffsbrüchige und unterhalten Seeleute mit Spielen. Sie werden oft auf Delphinen reitend dargestellt. Nymphen als Allegorie des Wassers waren bevorzugter Skulpturenschmuck an Brunnen der Renaissance und vor allem des Barock. Die Wald- und Baumnymphen verkörpern die Dryaden, Hamadryaden und Meliaden. Zu den Berg- und Grottennymphen zählen die Oreaden. https://de.wikipedia.org/wiki/Nymphe https://www.geschichte-abitur.de/griechische-mythologie-a-bis-z/nymphen |
|||||||||||||||||||||||||||
| Oberflächengewässer | Ein Oberflächengewässer ist ein in der Natur fließendes oder stehendes Gewässer, welches in den natürlichen Wasserkreislauf eingebunden ist. Hierzu zählen Flüsse, Seen, Übergangs- und Küstengewässer. Entsprechend ihrer naturräumlichen Eigenschaften werden sie in Gewässertypen unterteilt.
https://www.geothermie.de/bibliothek/lexikon-der-geothermie/o/oberflaechengewaesser.html
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Oberflächenspannung | Die Oberflächenspannung ist die infolge von Molekularkräften auftretende Erscheinung bei Flüssigkeiten, ihre Oberfläche klein zu halten. Die Oberfläche einer Flüssigkeit verhält sich ähnlich einer gespannten, elastischen Folie. Dieser Effekt ist zum Beispiel die Ursache dafür, dass Wasser Tropfen bildet, und trägt dazu bei, dass einige Insekten über das Wasser laufen können oder eine Rasierklinge auf Wasser „schwimmt“. Die Oberflächenspannung bei Wasser ist unter anderem abhängig von seiner Temperatur. Wird sie höher so nimmt die Oberflächenspannung ab. Chemische Stoffe, insbesondere Tenside verringern die Oberflächenspannung signifikant. Ein paar Tropfen Spülmittel reichen beispielsweise aus, dass auf einem Teich sich kein Wasserläufer mehr an der Oberfläche halten kann.
https://de.wikipedia.org/wiki/Oberfl%C3%A4chenspannung
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Oberflächenwasser | Alles Wasser über der Erdoberfläche. Von den gesamten Süßwasserressourcen der Erde liegen knapp 70% in Form von Eis und Schnee vor, geschätzte 0,26% als Seen, 0,03% als Feuchtgebiete und 0,006% als Flüsse. |
|||||||||||||||||||||||||||
| Oberharzer Wasserregal | Historisches System zur Umleitung und Speicherung von Wasser, um Wasserräder in den Bergwerken des Oberharzes anzutreiben, entstanden im 16. bis 19. Jahrhundert. Weltweit bedeutendstes vorindustrielles Wasserwirtschaftssystem des Bergbaus. Seit 2010 UNESCO-Weltkulturerbe. (Regal = königliches Hoheitsrecht).
Heute werden 65 Stauteiche, 70 km Gräben und 20 km Wasserläufe (unterirdisch verlaufender Teil eines Grabens) des Oberharzer Wasserregals von den Harzwasserwerken betrieben (Trinkwasserversorgung, Bade-, Angelteiche). Daneben existieren noch mehrere hundert Kilometer Gräben sowie eine Vielzahl von Dammresten und Wasserlaufmundlöchern, die einen passiven Denkmalschutz genießen, d.h. sie sind einem sehr langsamen Verfall preisgegeben, vergleichbar einer Burgruine. |
|||||||||||||||||||||||||||
| Ockerquelle | Ein Spezialfall einer Mineralquelle. Dort reagieren gelöste Metalle mit Luftsauerstoff und werden als Ocker ausgefällt. Dieser Vorgang wird durch verschiedene Bakterien unterstützt. Ocker tritt dabei vor allem in Form von orangefarbenem Eisenocker auf, der sich als Substrat ablagert. |
|||||||||||||||||||||||||||
| Offenlandquelle | |
|||||||||||||||||||||||||||
| Ökologischer Hochwasserschutz | Je nach Größe des Einzugsgebietes eines Gewässers und der Niederschlagsverhältnisse tragen menschliche Landnutzung und Gewässerausbau zu einer Verschärfung der Hochwassersituation durch Erhöhung des Oberflächenabflusses und verringerten Rückhalt in der Aue (natürliche Überflutungsflächen) des Gewässers bei. Häufige Ursache ist die Flächenversiegelung, aber auch die Intensivlandwirtschaft kann einen erheblichen Beitrag zur gesteigerten Abflussbildung leisten. Dass dabei selbst auf ungesättigten Böden Oberflächenabfluss auftritt, ist nicht in der Größe der Porenräume zu begründen, sondern liegt an der Durchlässigkeit der obersten Bodenschicht. Dort wird das Bodengefüge bei Regenereignissen durch Verschlämmung oft undurchlässig. Hinzu kommen die Eingriffe in das natürliche Gleichgewicht des Flusssystems. Uferbefestigungen, Wehre, Staudämme und Flussbegradigungen haben bewirkt, dass in weiten Teilen Europas und Nordamerikas die Auen als natürliche Retentionsräume (natürliche Überflutungsflächen) und komplexe Ökosysteme aus dem Landschaftsbild verschwunden sind. Durch Anreizmechanismen wie landwirtschaftliche Förderung für extensivere Nutzungen, Maßnahmen zur Entsiegelung von Flächen, dezentrale Regenwasserbewirtschaftung in Siedlungsgebieten und die Förderung der natürlichen Gewässerentwicklung, z. B. Flussrückbau und Auenvernetzung, wird versucht, dieser Dynamik entgegen zu wirken.
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochwasserschutz https://buess-leben.de/onewebmedia/HWS-FAQ-2015-02-21.pdf https://www.wasseraktiv.at/wasser-lexikon/173,oekologischer-hochwasserschutz.html |
|||||||||||||||||||||||||||
| Oligotrophes Gewässer | Gewässer können anhand der in ihr befindlichen Menge von Nährstoffen klassifiziert werden. Grundlegend unterscheidet man etwa bei Seen zwischen vier Trophiesystemen: Oligotroph (I), Mesotroph (II), Eutroph (III) und Hypertroph (IV). Oligotrophe Seen sind Gewässer mit nur sehr wenigen Nährstoffen, Hypertrophe Seen sind dagegen äußerst Nährstoffreich. Die zwei wichtigsten und häufigsten Trophiensysteme sind oligotrophe und eutrophe Gewässer. Seen lassen sich unter diesem Aspekt folgendermaßen systematisieren:
Durch landwirtschaftliche Nutzung, Nährstoffeintrag aus Kläranlagen und der Luft sowie vielfältige andere industriell-zivilisatorischen Einflüsse steigt der Nährstoffgehalt von Wasser trotz vieler Verbesserungsmaßnahmen weltweit noch immer an. Wegen der Kreislaufführung ist davon nicht nur von Oberflächenwasser einschließlich Meerwasser betroffen, sondern auch unter der Erdoberfläche fließendes Wasser und Gletscher. Die bekanntesten Nährstoffe sind Phosphor, Nitratstickstoff und Ammoniumstickstoff. Selbst an vielen Quellen lässt sich mittlerweile deren zu hoher Nährstoffgehalt in Form eines übermäßigen Wachstums von Faden- und Schleimalgen beobachten.
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Orthophoto | entzerrte Luftaufnahme eines Gebiets |
|||||||||||||||||||||||||||
| Ortstein | Dichter, harter, oberflächennaher Bodenhorizont, der das Durchdringen von Wurzeln und Wasser verhindert.
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Osmose | Passage eines Lösungsmittels von einer verdünnten Lösung zu einer höher konzentrierten Lösung durch eine halbdurchlässige Membran, d.h. einer Membran, die nur durchlässig ist für das Lösungsmittel.
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Osmotischer Druck | Besonderer Druck, der bei einer Lösung angewendet werden muß, um zu verhindern, daß infolge von Osmose Lösungsmittel durch die halbdurchlässige Membran eindiffundieren, d.h. einer Membran, die nur für das Lösungsmittel durchlässig ist.
|